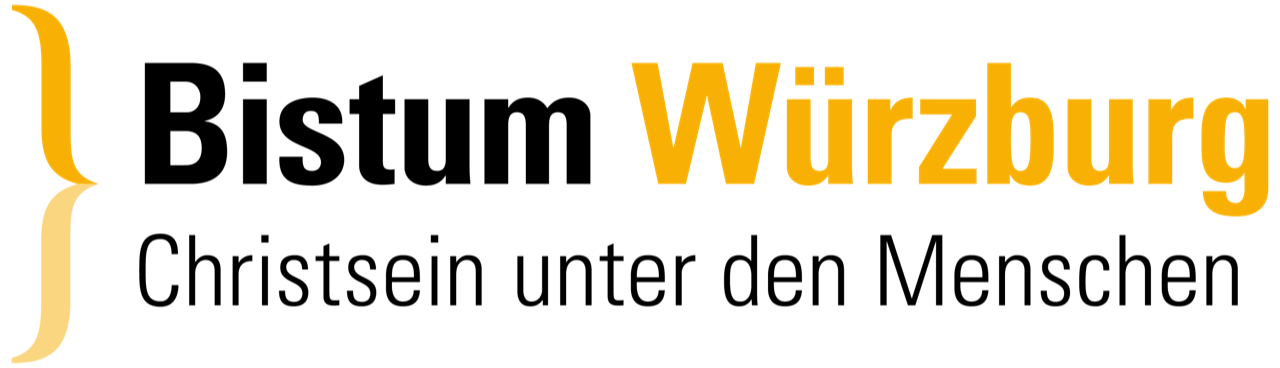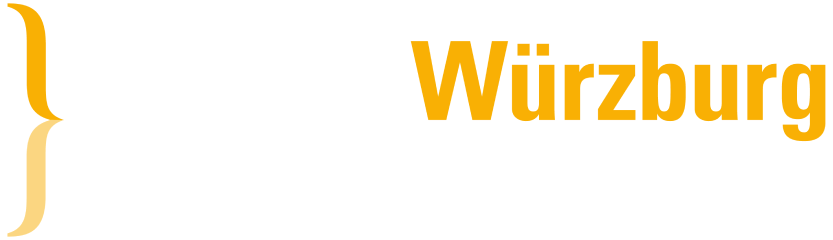in: Praxisbuch zum Mehr-Wert nachhaltiger Landwirtschaft, S. 115-121
Henry Ford, der Pionier des Automobilbaus hatte um 1900 die Vision – noch bevor Erdöl ein Thema war – „…to build a vehicle affordable to the working family and powered by a fuel that would boost the rural farm economy“ („…ein Fahrzeug zu bauen, das sich die arbeitende Familie leisten kann und von einem Kraftstoff angetrieben wird, der die landwirtschaftlichen Haushalte wirtschaftlich fördert.“) In seiner Vision war Ethanol aus Mais der Kraftstoff, der diese Bedingungen erfüllen würde.
Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls hat sich die Europäische Union verpflichtet, bis zum Jahr 2012 den jährlichen Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid um rund 8 % zu reduzieren. Die Förderung von Energieerzeugnissen aus Biomasse steht daher verstärkt in der Diskussion.
Zur Frage, ob man ausgerechnet Getreide zwecks Energiegewinnung verbrennen darf, gibt es in Kirche und Gesellschaft eine heftige und sehr kontroverse Debatte. Ökonomisch gesehen scheint das Verbrennen sinnvoll, da der Markt den Energiewert von Getreide gegenwärtig monetär höher beurteilt, als seinen Wert als Nahrungsmittel. Landwirte, die z. B. ihren Weizen in die Nahrungsmittelkette zum Backen von Brot einspeisen, verzichten teilweise auf 30 % ihres möglichen Verdienstes. Auch ökologisch gibt es starke Argumente für das Verheizen: Angesichts der Debatte um Treibhauseffekt und Klimawandel könnte man das „Heizen vom Acker“ als Teil-Ausweg aus der durch fossile Energienutzung zu befürchtenden Klimakatastrophe betrachten.