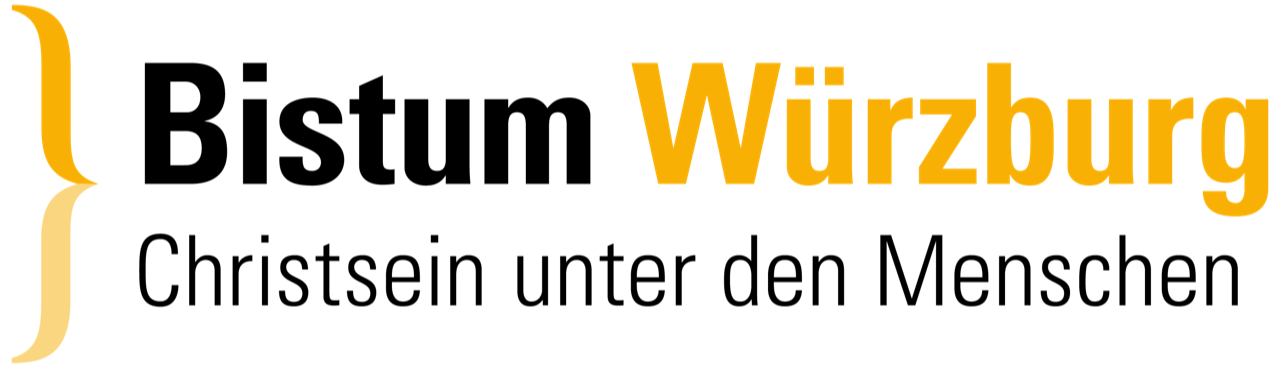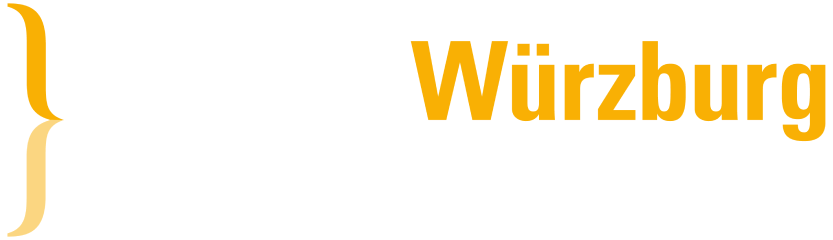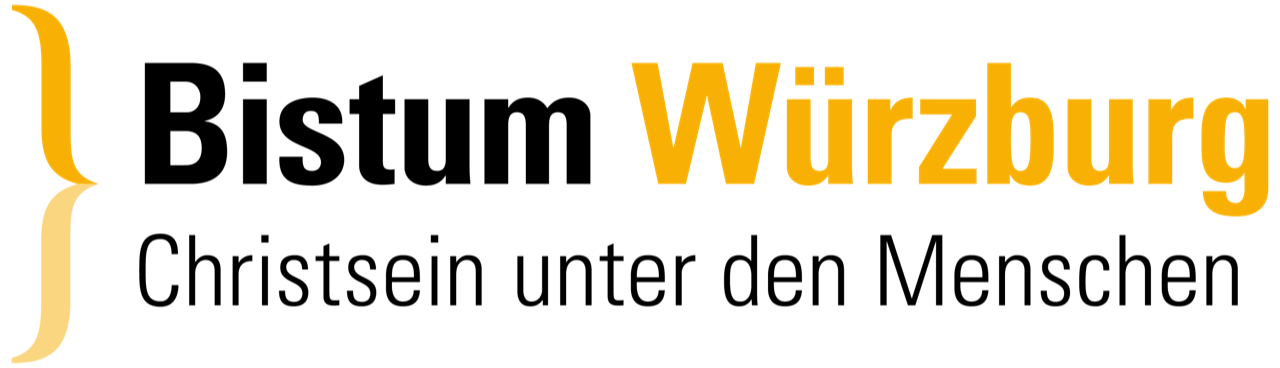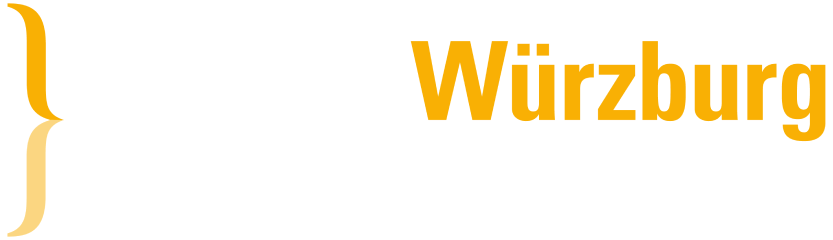Seit 11. Februar ist es amtlich - die Bundesregierung hat aufgrund von Vorgaben der Europäischen Union ein „Gesetz zur Neuordnung des Gentechnikrechts“ beschlossen und auf den parlamentarischen Weg gebracht. Demnach dürfen künftig in Deutschland unter bestimmten Auflagen gentechnisch veränderte Nutzpflanzen angebaut und daraus hergestellte Lebensmittel vermarktet werden; der seit sechs Jahren geltende Anbaustopp soll aufgehoben werden. Schon für dieses Frühjahr ist in Sachsen-Anhalt großflächig die Aussaat von sog. „Gen-Mais“ geplant.
Was hat es mit diesem „Gen-Mais“ auf sich? Stellt er für Verbraucher und Landwirte einen Fortschritt dar, den es ohne falsche Scheu zu nutzen gilt, oder gehen von seinem Anbau und Verzehr unabsehbare Risiken für Umwelt und Gesundheit aus? Diese Fragen, die nun jeden Bürger berühren, werden kontrovers diskutiert.
Nutzen erhofft
Der „Gen-Mais“ ist ein Anwendungsfall der ‚Grünen Gentechnik’, d. h. der gentechnischen Veränderung von Nutzpflanzen. Hierbei wird versucht, durch das Einschleusen von bestimmten Erbgutabschnitten (Genen) artfremder (!) Organismen in das Erbgut von Nutzpflanzen deren Eigenschaften positiv zu verändern - etwa ihren Ertrag zu steigern, ihre Qualität zu verbessern oder sie gegen Schädlinge resistent zu machen. Letzteres ist beim „Gen-Mais“ der Fall. In die Maispflanze wurde ein Gen eines Bakteriums übertragen, das sie in die Lage versetzt, ein Gift gegen einen tückischen Schädling (Maiszünslerraupen) zu produzieren und sich so vor diesem zu schützen. Damit seien künftig die Erträge der Maisbauern besser gesichert; zugleich könnten die Bauern auf umweltbelastende (und nur begrenzt wirksame) Schädlingsbekämpfungsmittel verzichten, was allen und dem Naturhaushalt zugute käme.
Widernatürlich und wider die Schöpfungsordnung?
Ehe diesen Vorteilen die Probleme gegenübergestellt werden, ist zu klären: Sind erbgutverändernde Maßnahmen grundsätzlich illegitim und verwerflich? Verfechter dieser Position behaupten: „Gentechnische Eingriffe sind widernatürlich.“ Und: „Die göttliche ‚Schöpfungsordnung’ wird durch die Gentechnik verletzt“. Der Mensch pfusche dem Schöpfer ins Handwerk und spiele sich hier selbst zum Schöpfer auf.
Die Berufung auf die Natur ist aus mehreren Gründen fehlerhaft. Einen Gentransfer über Artgrenzen hinweg gibt es durchaus auch in der Natur; das Einschleusen artfremder Gene kann folglich nicht als wider-natürlich gebrandmarkt werden. Aus der bloßen Feststellung, dass etwas natürlich oder nicht natürlich ist, kann zudem nicht unmittelbar gefolgert werden, dass es deshalb auch schon gut und zu tun (bzw. schlecht und zu meiden) ist. So lässt sich aus der natürlichen Tatsache, dass der Mensch keine Flügel besitzt, nicht schließen, dass er sich nicht in die Lüfte erheben darf. Die Natur (die ‚Natürlichkeit’ oder ‚Unnatürlichkeit’ einer Sache) kann daher nicht das maßgebliche Kriterium für das menschliche Urteilen und Handeln sein.
Der Versuch, für eine kategorische Ablehnung der Gentechnik mit der göttlichen Schöpfungsordnung zu argumentieren, erweist ebenfalls als problematisch: Eine solche Begründung könnte wohl nur Gläubige überzeugen – in der gesellschaftlichen Debatte eine große Schwäche! Inhaltlich ist zu bedenken: Gottes Schöpfersein erstreckt sich auf alles, was ist, umfasst also auch den Menschen und dessen Handlungsmöglichkeiten. Sein Handeln kann daher zu Gott überhaupt nicht in Konkurrenz treten und ihm ‚ins Handwerk pfuschen’. Ebenso wenig ist es möglich, aus dem Geschaffensein aller Wirklichkeit die Unantastbarkeit eines Teilbereiches - z. B. der genetischen Strukturen - abzuleiten. Ferner ist nicht ersichtlich, warum der Mensch ausgerechnet durch die Gentechnik einen unstatthaften Eingriff in die ‚Schöpfungsordnung’ vornimmt und ‚sich zum Schöpfer aufspielt’, nicht jedoch etwa durch die Herstellung synthetischer Stoffe. Und nicht zuletzt hat der Mensch einen Weltgestaltungsauftrag (Gen 1,28), den er eigenverantwortlich wahrnehmen soll.
Maßgebliches Kriterium der Beurteilung: Die Folgen gentechnischer Eingriffe
In erster Linie sind dabei die gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen in den Blick zu nehmen, ferner soziale und strukturelle Aspekte.
Was die gesundheitlichen Auswirkungen anbetrifft, so gibt es nach heutigem Erkenntnisstand keine Hinweise, dass der Verzehr von „Gen-Mais“ für den Menschen eine Gefahr darstellt. Sowohl das Risiko der Auslösung einer allergischen Reaktion als auch der Ausbildung von Resistenzen gegen Antibiotika (Antibiotikaresistenz-Gene werden bei der Erbgutveränderung aus technischen Gründen mit übertragen) wird als äußerst gering eingestuft. Auch soll der Verbraucher durch Kennzeichnung von Lebensmitteln, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, die Wahlfreiheit zwischen genetisch modifizierten und natürlichen Produkten behalten.
Hinsichtlich der ökologischen Folgen fällt die Bilanz weniger eindeutig aus: „Gen-Mais“ verringert den Einsatz chemischer Insektizide und trägt damit zum Schutz von Mensch und Natur bei. Andererseits werden durch das von der Maispflanze produzierte Gift möglicherweise auch andere Organismen geschädigt, die für den Menschen bzw. das ökologische Gleichgewicht von erheblicher Bedeutung sind (allerdings trifft dies in hohem Maß auch für herkömmliche Schädlingsbekämpfungsmittel zu). Weiterhin ist damit zu rechnen, dass der Maiszünsler sich allmählich gegen den Giftstoff immunisiert. Dann stünde dieser biologische Schädlingsbekämpfungsstoff nicht mehr zur Verfügung; er ist aber für den ökologischen Landbau derzeit die einzige ‚Biowaffe’ bei massivem Befall.
Das Risiko, dass Pollen von „Gen-Mais“ auf konventionelle Maissorten übertragen werden und der „Gen-Mais“ sich dadurch unkontrolliert ausbreitet, lässt sich nicht ausschließen, soll aber durch gesetzliche Auflagen – z.B. Mindestabstände, Schutzpflanzungen - in engen Grenzen gehalten werden. Negative Auswirkungen – etwa auf die Artenvielfalt – wären unumkehrbar.
Das Gesetz sieht zwar vor, dass die Landwirte, die „Gen-Mais“ anbauen, dann gesamtschuldnerisch haften und zu Ausgleichszahlungen verpflichtet sind, wenn durch Auskreuzung konventionell bzw. ökologisch wirtschaftende Erzeuger ihre Produkte nicht mehr als „ohne Gentechnik“ kennzeichnen und veräußern können. Konsequent rät das Kommissariat der deutschen Bischöfe: „Wenn der Gesetzgeber selbst bezweifelt, dass eine Koexistenz zwischen ökologischem oder konventionellem Anbau und Anbau genveränderter Pflanzen auch bei Einhaltung der guten fachlichen Praxis gelingen kann, sollte auf eine Genehmigung und Freisetzungen derzeit verzichtet und weiter geforscht werden.“
Fazit: Kein Freibrief
Wenngleich sich eine „Verteufelung“ von „Gen-Mais“ (und ‚Grüner Gentechnik’) nicht rechtfertigen lässt, ist ihm damit noch lange kein Freibrief ausgestellt. Neben dem Gebot einer sorgfältigen Folgenabschätzung für jede weitere gentechnische ‚Errungenschaft’ bei Nutzpflanzen bleibt die Frage, ob die ‚Grüne Gentechnik’ sich nicht mit immensem technischem und finanziellem Aufwand an Problemen abarbeitet, die erst durch die Intensivlandwirtschaft hervorgebracht werden (z. B. die hohe Schädlingsanfälligkeit aufgrund von Monokulturen). Gerade diese Form der Landwirtschaft gälte es aber in absehbarer Zeit zu verändern in Richtung eines sozial und ökologisch verträglichen Landbaus. Dann bräuchte es vielleicht gar keinen „Gen-Mais“ mehr.
Thomas Brandecker
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Moraltheologie der Universität Würzburg und Mitglied des Sachausschusses ‚Bewahrung der Schöpfung’ der Diözese Würzburg.